Über viele Jahre hinweg habe ich für meinen Blog „Denkraum“ insgesamt ca. 250 Beiträge geschrieben – von unterschiedlicher Qualität und Relevanz. Einige davon möchte ich kennzeichnen als „Über den Tag hinaus…“.
- Der Mensch – ein „Gott der Erde“?
- „Das Gewebe dieser Welt ist aus Notwendigkeit und Zufall gebildet; die Vernunft des Menschen stellt sich zwischen beide und weiß sie zu beherrschen; sie behandelt das Notwendige als den Grund ihres Daseins; das Zufällige weiß sie zu lenken, zu leiten und zu nutzen. Und nur, indem sie fest und unerschütterlich steht, verdient der Mensch, ein Gott der Erde genannt zu werden.“ Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre I,17
- Wie steht es nun heute mit der Vernunft des „homo sapiens“?
- Delphine – mit dem Kapitalismus konfrontiert.
- Wenn Tiere zur Ware werden, werden Menschen zum Tier. Raubtiere töten ihre Beute jedoch meistens rasch und gezielt. Was im Video gezeigt wird, das brutale Abschlachten von Delphinen, ist Teil unserer Wirklichkeit. Schauen Sie es sich nur dann an, wenn Sie einiges abkönnen.
- Osterbotschaft: „Wie hältst Du’s mit der Religion?“
- Dem Gedankengut der Aufklärung verpflichtet, will ich daran erinnern, dass es mit dem historischen Jesus, seiner Auferstehung und dem leeren Grab so eine Sache ist.
- Der Anschlag vom 11. September – ein Kunstwerk?
- Der heutige Artikel des „Transatlantikblogs“ zum 11. September versteigt sich ernsthaft zu der These, die Terroranschläge von 9/11 sollten als „Kunstwerk“ betrachtet werden. Ein Interview des Komponisten Stockhausen wird zitiert, in dem dieser den Anschlag als „das größtmögliche Kunstwerk, was es je gegeben hat“ bezeichnete.
- Kunst oder Leben, das ist hier die Frage
- Nachdem der Verfasser des von mir kommentierten Artikels aus dem Transatlantikblog seine Aussagen ergänzt und überarbeitet hat, habe ich ihm einen weiteren Kommentar gesandt: „Sie machen in Ihrem Artikel durchgängig einen Denkfehler – denselben wie seinerzeit Stockhausen. Sie verlieren einen entscheidenden kategorialen Unterschied aus dem Blick: den zwischen einem Kunstwerk als einem Produkt menschlicher Phantasie, das auf einer Zeichenebene, einer symbolischen Ebene, zum Ausdruck gebracht wird, und der tatsächlichen Umsetzung von Phantasien im wirklichen Leben.„
- Joseph Stiglitz: Das war’s, Neoliberalismus
- In dichter, überzeugender Argumentation entzaubert Stiglitz, der vor allem durch sein Buch „Die Schatten der Globalisierung“ als Globalisierungskritiker bekannt wurde, den Neoliberalismus als ökonomische Irrlehre und legt deren verheerende Folgen für zentrale Wirtschaftsbereiche dar.
- Absturzgefahr: Ikarus und der fragile Kapitalismus
- Banken verlieren mal eben das Vertrauen in ihre gegenseitige Kreditwürdigkeit, hören einfach auf, sich untereinander Geld zu leihen, und schon droht das ganze System zu kollabieren. Die Brisanz der Lage, die Größenordnung des drohenden Problems, das sich da im Stillen aufgebaut hat, haben wir massiv unterschätzt. Einige wenige Bankpleiten und -schieflagen können eine fatale Kettenreaktion auslösen und das gesamte Finanzsystem zur Implosion führen. Und der entscheidende Transmissionsriemen ist das fehlende Vertrauen der Banker in ihre eigene Branche.
- Nobelpreisträger Stiglitz: „Schlimmer als die Große Depression“
- Die Aufgabe der Banken ist es, Kapital zu sammeln, es aufzuteilen und die Risiken zu beherrschen. Dafür werden sie belohnt. Mehr als 30 Prozent aller Unternehmensgewinne in den USA sind in die Finanzbranche geflossen. Aber sie haben ihre Aufgabe nicht erfüllt. Sie haben das Risiko nicht beherrscht, sie haben es erst geschaffen.
- „Steinbrück, Du hast keine Wahl“: Schreiben von Bundesbank und BaFin an den Finanzminister
- In einem Schreiben vom 29. September 2008 erläutern Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) dem Finanzminister, warum es zu einer Rettung der Hypo Real Estate Bank keine Alternative gibt, und warum der Staat sich mit einer Milliardenbürgschaft daran beteiligen muss. Wer sich aus erster Hand einen Eindruck verschaffen möchte, an welchem Abgrund unser Finanzsystem stand, und warum Regierungen sich in dieser Situation ohnmächtig mit dem Rücken zur Wand vorfinden, dem sei die Lektüre des sechsseitigen, von Bundesbankpräsident Weber und BaFin-Chef Sanio unterzeichneten Schreibens wärmstens empfohlen.
- Wie es zur Finanzkrise kam – die ultimative Erklärung
- In einem fiktiven Interview eines Fernsehjournalisten mit einem Investmentbanker liefern zwei englische Komiker, John Bird und John Fortune, die ultimative Erklärung, wie es zur Finanzkrise kam. Herausragend! Satire vom Feinsten. British humor at its best!
- „Die Welt ist aus den Fugen“: von der Macht der Finanzwirtschaft und der Ohnmacht der Politik
- „The time is out of joint“ („die Zeit ist aus den Fugen“), so lautet das Resumé des Dänenprinzen Hamlet, nachdem der Geist seines ermordeten Vaters ihm die Augen geöffnet hat für die verkommenen Verhältnisse im mittelalterlichen Staate Dänemark. In der Welt von Shakespeares Tragödien sind es regelmäßig einzelne Personen, die mit ihren oft monströsen Charakterschwächen Unheil über Land und Leute bringen.
- Das Monster, das unsere heutige Welt im Griff hat wie ein Riesenkrake, ist ein gesellschaftliches Subsystem, die Finanzwirtschaft. Mit gigantischen Kapitalbeträgen agiert sie an kaum regulierten Märkten und stellt zunehmend eine Parallelgesellschaft dar. Die Funktionsmechanismen dieses in den letzten Jahrzehnten einerseits immer komplexer und andererseits immer mächtiger gewordenen ökonomischen Teilsystems sowie die Wirkungen und Sekundärfolgen dieser Mechanismen sind kaum noch zu durchschauen. In seiner heutigen, globalisierten Form ist das Finanzmarktsystem praktisch unkontrollierbar geworden.
- Rechtsextreme Mentalität
- Grundlage rechtsextremer Mentalität ist ein komplexes psychisches Regulationsgeschehen, ein dynamisches Zusammenspiel von psychischen Motiven, Emotionen, Abwehrmechanismen, Werthaltungen und Einstellungen vor dem Hintergrund von Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung. Rechtsextreme Mentalität entsteht nicht aus Einstellungen und Werturteilen der Betroffenen als Ergebnis mehr oder weniger rationaler Überlegungen. Die Ansichten und Werturteile, die eine „rechtsextreme Gesinnung“ ausmachen, sind Folge tiefergehender psychischer Motive, und die vermeintlich rationalen Begründungen dieser Ansichten sind lediglich Rationalisierungen.
- Breivik – schuldfähig oder schuldunfähig?
- Es scheint mir eindeutig, dass bei Anders Behring Breivik eine schwere kombinierte Persönlichkeitsstörung mit narzisstischer, antisozialer und paranoider Akzentuierung vorliegt. Daher stellt sich die Frage, ob er das Unrechtmäßige seines Handelns erkennen und nach dieser Einsicht handeln konnte, oder ob seine verzerrte Realitätswahrnehmung im Rahmen seines ideologischen Denksystems diese Erkenntnis bzw. ein Handeln danach verhindert hat.
- So ähnlich fing es auch 1968 an…
- … damals aber noch ohne „social media“. Nicht auszudenken, was heute mit Hilfe von Facebook, Twitter etc. daraus werden kann!
- Endlich, endlich wachen die jungen Leute wieder auf, wie wir vor 40 Jahren. Wir hatten damals die Nase voll von sozialer Ungerechtigkeit, von unverdienten Privilegien einiger weniger und von Traditionen, die der Unterdrückung unserer Lebensfreude dienten. In ein politisches System, das seine Wurzeln in der Kaiserzeit hatte, das in Spießigkeit erstarrt war und in dem allerorten noch faschistoide Dumpfbackigkeit angesiedelt war, wollten wir frischen Wind bringen. Das ist uns auch gelungen.
- Von der scheinrationalen Volkswirtschaftslehre zum absurden Finanzkapitalismus
- Die scheinbare Rationalität der vorherrschenden ökonomischen Theorien beruht auf irrationalen Hypothesen über den Menschen als Wirtschaftssubjekt (ähnlich wie im Fall des Marxismus, nur sind die Irrtümer andere). Falsche Grundannahmen haben zu einem bizarren Theoriegebäude und in der Folge zu einem absurden finanzgesteuerten Kapitalismus geführt. Diese sich mehr und mehr durchsetzende Erkenntnis erläutert der französische Ökonom André Orléan in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk.
- Zapfenstreich, Mob und Zivilgesellschaft
- Es war nicht das wesentliche Problem, was im Garten von Schloss Bellevue feierlich zelebriert wurde, sondern das, was draußen geschah. Da lärmte, aufgewiegelt durch einen Tsunami von Skandaljournalismus, der unser Land drei Monate lang überflutete, der moderne Mob.
- Noch während der gesamten Dauer eines Strafverfahrens ist jeder Verdächtigte oder Beschuldigte als unschuldig zu behandeln. Falls es zu einer Verurteilung kommt, endet die Unschuldsvermutung erst mit deren Rechtskraft. Zudem hat nicht der Beschuldigte seine Unschuld, sondern die Strafverfolgungsbehörde seine Schuld zu beweisen. Das sind wohlerwogene Prinzipien unseres Rechtssystems, die vor ungerechtfertigter Verfolgung, falscher Verdächtigung, Verleumdung oder übler Nachrede – allesamt Straftatbestände – schützen sollen.
- Der Mob sieht dies von Grund auf anders. Der hält sich mit derlei Feinheiten nicht auf, sondern hat – in seiner Empörungsbereitschaft von den Skandalisierungsmedien hinreichend angestachelt – sein Schuldurteil längst gefällt. Weder berücksichtigt er die genauen Umstände des Verhaltens des Verdächtigten noch dessen Motive. An entlastenden Gesichtspunkten ist er erst gar nicht interessiert. In der Hingabe an seine Gefühlswallungen ist ihm das Prinzip der Verhältnismäßigkeit völlig abhanden gekommen. Entrüstung, Häme und Schadenfreude erfüllen die medienseitig aufgewiegelten Wutbürger und führen zu einer hochgradigen Trübung ihres Erkenntnis- und Urteilsvermögens. Das gilt für die justitiablen Aspekte der Angelegenheit ebenso wie für die nicht-justitiablen, in der Sphäre von Stilfragen angesiedelten.
- Unsere teilweise Jahrhunderte alten kulturellen Errungenschaften haben gestern versagt. Eine offizielle Verabschiedung eines Bundespräsidenten, mit welchem Zeremoniell auch immer, und mag man von dem Mann halten, was man will, durch massiven Einsatz lärmender Tröten nachhaltig zu stören, zeigt nicht nur eine überaus verrohte Intoleranz, Mitleidlosigkeit und menschliche Kälte, es ist auch eine Form von Gewalt.
- Das Grass-Gedicht: Was wirklich gesagt wird
- Die Debatte um das Grass-Gedicht ist vollkommen aus den Fugen geraten. Zahllose Kritiker erheben Vorwürfe, die jedes vernünftige Maß übersteigen. Als Leser steht man oft unter dem Eindruck, es ist nicht der Grass-Text, der kommentiert wird, sondern die durch das Gedicht angeregte ausschweifende Phantasie des Kommentators. Viele Kritiker lassen ihrem Ärger und Zorn über das provokante Werk des Nobelpreisträgers freien Lauf, ohne zu realisieren, wie sie damit einer nachträglichen Rechtfertigung Grass’scher Aussagen nur in die Hände spielen. Für nachdenkliche Zeitgenossen sind solcherart Kritiken, die ihre pauschale Verurteilung des Gedichts und seines Autors häufig noch mit der Keule des Antisemitismus-Vorwurfs anreichern, eine Zumutung.
- Der Sache angemessen ist allein eine am realen Grass-Text mit seinen zahlreichen Thesen, Behauptungen und Argumenten und an den sonstigen Fakten orientierte differenzierte Interpretation und Beurteilung des Gedichts. Grundlage einer kritischen Analyse muss zunächst der Textgehalt sein – das, was in „Was gesagt werden muss“ tatsächlich gesagt wird. Um dem näher zu kommen und die mühsam verschachtelte (Prosa-) Gedichtform des Literaturnobelpreisträgers lesbarer zu machen, wird der Text hier in einem ersten Schritt zu einer erläuternden und bewertenden Kommentierung zunächst in Prosaform wiedergegeben.
- „Paradigm Lost“: Ökonomen erkennen Holzweg – zu spät für Europa?
- Die zunehmenden Warnungen, mit der derzeitigen Euro-Krisenstrategie sei man auf dem Holzweg, sind eingebettet in eine umfassendere Entwicklung mit äußerst weitreichenden Konsequenzen für die weltweite Wirtschafts- und Finanzpolitik: eine sich abzeichnende grundlegende Neuorientierung der Wirtschaftswissenschaften. Angesichts der immensen Bedeutung dieses beginnenden und derzeit aus dem akademischen Raum in den politischen Raum vordringenden Paradigmenwechsels der ökonomischen Wissenschaften wird der Denkraum sich diesem Thema demnächst vorrangig widmen.
- Als Einführung in die Thematik hier ein kürzlicher Leitartikel von Stephan Kaufmann für die Frankfurter Rundschau, in dem unter dem Titel „Das gescheiterte Weltbild der Wirtschaft“ über eine viel beachtete internationale Konferenz des Institute for New Economic Thinking (INET) mit dem Thema “Paradigm Lost: Rethinking Economics and Politics“ berichtet wird, die im April in Berlin stattfand.
- Wie halten Sie’s mit der Religion?
- Gewiss macht es für christlich erzogene Menschen einen wesentlichen Unterschied, ob sie auch als Erwachsene noch gläubig sind, sich also mit den christlichen Glaubensinhalten identifizieren, oder nicht. Wer in der einen oder der anderen Richtung eine klare, eindeutige Position gefunden hat, sei es als gläubiger Christ oder als ungläubiger Atheist, hat diese Haltung vermutlich in sein geistiges und seelisches Leben integriert und ist in diesem Punkt mit sich im Reinen.
- Wie steht es aber mit der großen Gruppe derjenigen, die nicht so recht wissen, was Sie von Gott und der Religion halten sollen? Die zahlreichen Zeitgenossen, die am christlichen Glauben zwar elementare Zweifel hegen, ihm aber niemals wirklich Lebewohl gesagt haben und die Frage nach ihrem Verhältnis zur Religion am liebsten unbeantwortet in der Schwebe belassen würden? Die vielen Schwankenden, die in ihrer Kindheit und Jugend ganz selbstverständlich in eine christliche Glaubenswelt hineingewachsen sind, sich im Laufe ihrer späteren Entwicklung aber ein rational geprägtes Weltbild angeeignet haben, in dem Jesus Christus und der liebe Gott nur noch schwer einen Platz finden.
- Für viele Menschen ist es eine selbstverständliche, vertraute Gewohnheit, sich auch dann noch als Christen zu verstehen, wenn ihr Glaube mit ihrer erwachsenen, rational denkenden Persönlichkeit nicht mehr übereinstimmt. Falls auch Sie zu denjenigen gehören, die sich aus alter Gewohnheit als Christ betrachten, die Glaubensinhalte der christlichen Religion jedoch genau genommen nicht mehr für wahr halten, weil ihr Verstand ihnen recht eindeutig sagt, „ein Schmarren, das Ganze“: Würden Sie offen und ehrlich dazu stehen, sich selbst und anderen gegenüber?
- „Kalter Friede“ in Europa – und die Welt im Griff der Finanzoligarchie
- Die Bedrohungslage der Zeit des Kalten Krieges wird mit dem heutigen Gefahrenszenario verglichen. Das Klima des Unfriedens ist in Europa heute größer als während des Kalten Krieges. Heute geht die Bedrohung vom Kapitalismus aus. Wir leben in einem Wirtschaftssystem, das außerordentlich fragil geworden ist. Die gegenwärtige Form des finanzmarktdominierten Kapitalismus droht sich selbst zu zerlegen. Das Szenario eines globalen Finanzcrashs ist in gewissem Sinne brisanter als das des Kalten Krieges, in dem zwei verfeindete Weltmächte die Gefahr durch ein „Gleichgewicht des Schreckens“ im Zaum hielten. Heute erwächst die Gefahr aus der Funktionsweise des Systems selbst. Die in die Hände der heutigen Finanzoligarchie geratene globalisierte Wirtschaft ist zu einem Tanz auf dem Vulkan geworden.
- „Es gibt keine Euro-Krise“ – Der unglaublich naive Euro-Kommentar des DIW-Präsidenten (2)
- Unter dem Titel „Es liegt nicht am Euro!“ veröffentlichte die „Zeit“ am 9. April 2013 einen Kommentar des seit Februar 2013 amtierenden Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher (42), zur gegenwärtigen Krise Europas. Im ersten Teil meines Artikels „’Es gibt keine Euro-Krise‘ – Der unglaublich naive Euro-Kommentar des DIW-Präsidenten“ habe ich dessen beruflichen Werdegang und die Umstände seiner Wahl geschildert sowie einige frühere Äußerungen des Ökonomen kommentiert. In diesem Teil nehme ich zu der zentralen These seines „Zeit“ – Artikels Stellung.
- Der Snowden-Coup – die ganze Tragweite in Kurzform
- Edward Snowden hat die Welt über die Abgründe der bislang unvorstellbaren Ausspähungspraktiken der Geheimdienste aufgeklärt. Dafür gebührt ihm der alternative Nobelpreis. Fassungslos macht einen indes nicht nur das Orwellsche Szenario, in dem wir alle inzwischen leben, sondern auch die abgrundtiefe Dummheit der Geheimdienstorganisatoren, zu glauben, man könnte diese menschenrechtsverachtenden Praktiken angesichts von mehr als 850.000 (nach anderen Quellen 1,4 Millionen) Mitarbeitern von NSA und Co. geheimhalten, die Zugang zur Geheimhaltungsstufe Top Secret haben (nach amerikanischen Medienberichten ein Drittel davon Mitarbeiter von Privatunternehmen).
- Moderne Lyrik
- Ein Mensch, modern, kulturerpicht, denkt, „heut schreib ich mal ein Gedicht. Worüber, weiß ich noch nicht recht, doch jedenfalls wird es nicht schlecht.“
- Denn nach den Plänen dieses Herrn steht eines fest: „ich schreib’s ‚modern‘! Klar, das verlangt Inspiration, doch keine Angst, ich mach‘ das schon.“
(Wird fortgesetzt)



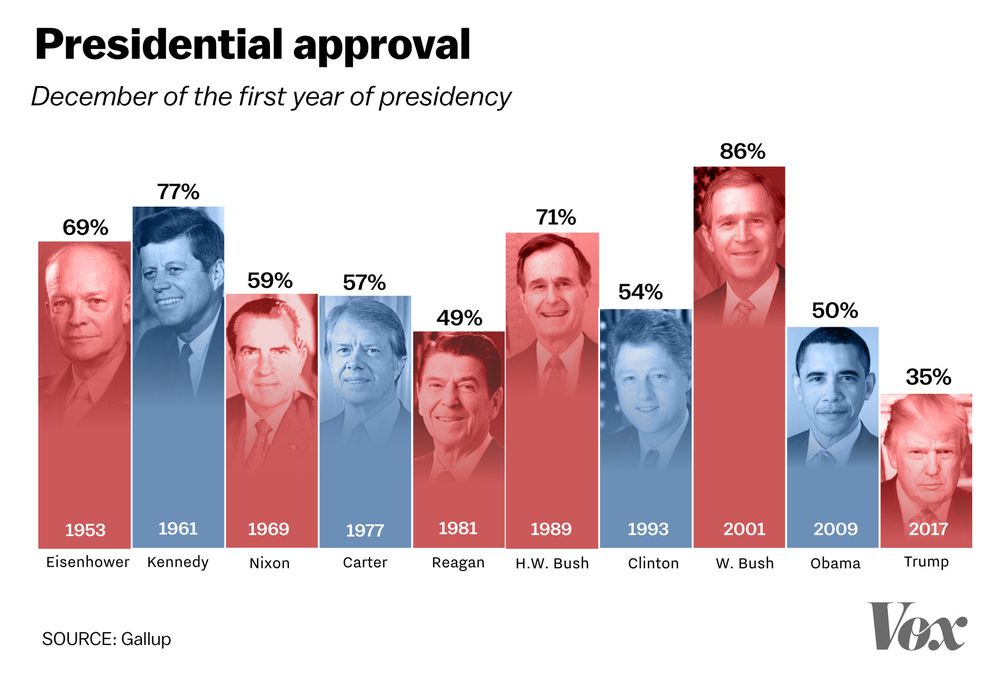
 Nach Berechnungen des am 14.11.2017 veröffentlichten diesjährigen
Nach Berechnungen des am 14.11.2017 veröffentlichten diesjährigen 
 Am 4. Oktober 2017 erschien in der Online-Ausgabe des traditions- und einflussreichen US-amerikanischen Magazins
Am 4. Oktober 2017 erschien in der Online-Ausgabe des traditions- und einflussreichen US-amerikanischen Magazins  Fareed Zakaria
Fareed Zakaria